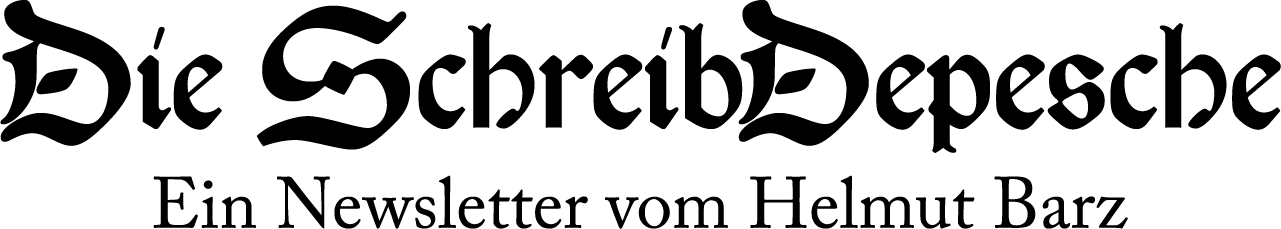Eine Kurzgeschichte
Ich stehe.
Ich stehe auf einem Bein.
Ich stehe auf einem Bein auf der Abdeckung eines Schornsteins eines Mietshauses am Rande von Frankfurt am Main. Unter mir der Verkehr einer Hauptstraße, über mir die Abenddämmerung.
Es ist so einfach, lange auf einem Bein zu stehen, egal wo, auf dem Boden, auf einem Schornstein oder auf der Spitze des Messeturms – und doch habe ich ewig dafür gebraucht, hinter das Geheimnis zu kommen; dabei ist es Zen für Anfänger: Stell dir vor, all deine Masse ist eine Kugel in deinem Bauch. Stell dir weiter vor, diese Kugel schrumpft zu einem Punkt. Ein Punkt kann sich nicht drehen, nicht kippen – er ist einfach nur. Innere Mitte nennt man das wohl.
Ich stehe also auf einem Schornstein, auf einem Bein und halte die Balance, was einen Beobachter angesichts des Sturzes, der mich erwartet, wenn ich sie nicht halte, wenig, angesichts meiner früheren mangelnden Balance aber sehr verwundern würde – vorausgesetzt, der Beobachter kennt mich. Doch ich bin allein. Auf der Straße ist man zu sehr mit dem Verkehr beschäftigt, um mich zu sehen, und der einzige Hausbewohner, der mich sehen könnte, wenn er aus dem Fenster blicken würde, schaut fern. Fußball, nehme ich an. Doch ich will gar keine Zuschauer, will niemanden beeindrucken, sondern einfach nur zehn Minuten hier stehen, auf meinem rechten Bein.
Ich konnte zwei Dinge nie: auf einem Bein stehen und Bälle fangen. In der Schule hatte ich zwei Sportlehrer, der eine unterrichtete zusätzlich Physik, der andere Biologie. Sie debattieren vermutlich heute noch über mich: Der Biologe attestierte mir eine Ballallergie, gab mir aber trotzdem eine Fünf, und der Physiker nannte es negative Anziehung von Rundkörpern und machte mich zum Kapitän der Völkerballmannschaft. Die Mannschaft wurde aber bei der Schulmeisterschaft disqualifiziert, da es mir auch nach zwei Stunden allein auf dem Spielfeld immer noch nicht gelungen war, einen Ball in die Hand zu nehmen und meinen Mannschaftskameraden zuzuspielen. Man einigte sich auf psychologisches Foul und steckte mich in die Schwimmmannschaft, vermutlich in der Hoffnung, dass sich im tiefen Wasser das Problem mit mir von selbst erledigen würde – weit gefehlt, und so wurde ich von meinem dritten Sportlehrer, der bevorzugt Philosophie unterrichtete, zur Amphibie erklärt. Damit konnte ich leben, und noch heute ist mein bevorzugter Aufenthaltsort die Badewanne.
Warum mich eines Tages der Ehrgeiz packte, auf einem Bein stehen zu wollen, wäre eine zu komplizierte Geschichte. Es reicht zu erwähnen, dass eine Physiotherapeutin zu meiner Nemesis, eine an Federn aufgehängte Platte zu ihrem Werkzeug wurde – es gelang mir einfach nicht, auf dieser Platte stehen zu bleiben. Schon gar nicht auf einem Bein.
«Mir fehle die innere Mitte», sagte sie. Dass für mich als Künstler so etwas wie eine innere Mitte nicht existiere und eine solche, sollte ich sie erwerben, zur sofortigen Berufsunfähigkeit führen würde: Diese Argumentation ließ sie nicht gelten. Und so kam es zu der verhängnisvollen Wette.
Dabei hatte es ganz harmlos angefangen. Eigentlich wollte ich sie nur zum Essen einladen, als Dank für ihre Mühe – Kochen kann ich, inzwischen sogar einbeinig. Wenn der geneigte Leser jetzt lacht, so möge er einmal versuchen, einbeinig Sahne zu schlagen. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört.
Jedenfalls sagte sie, sie ließe sich gerne von mir zum Essen einladen. Wenn ich es schaffe, zehn Minuten auf der Platte stehen zu bleiben. Selbstverständlich auf einem Bein. Und ebenso selbstverständlich auf meinem schwächeren Bein – dem rechten.
Und dann sagte ich den Satz, der mich auf diesen Schornstein geführt hat:
«Warum nicht gleich auf der Spitze des Messeturms?»
Konnte ich ahnen, dass sie mich ernst nimmt?
Jedenfalls verbringe ich seitdem jede freie Minute auf einem Bein. Und nachdem ich zunächst auf dem Boden, dann auf einer Milchkiste, dann auf einem Hocker und auf einem großen Ball stehen konnte, habe ich mich an das Freiluftszenario herangetastet. Der Schornstein gehört inzwischen zu meinem täglichen Trainingsparcours, ich habe aber schon an ganz anderen Orten gestanden. Ich denke, inzwischen bin ich so weit, dass ich es wagen kann.
Meine Armbanduhr piepst. Zehn Minuten sind um. Niemand hat Notiz von mir genommen. Es wäre auch, zugegeben, etwas schwer zu erklären, was ich auf dem Schornstein gemacht habe. Ich stelle es mir bildlich vor, während ich vom Schornstein heruntersteige und langsam über den Dachfirst balanciere, rückwärts – das wäre nicht nötig, ist aber ein gutes Training.
«Soso, Herr K., Sie haben also das Stehen auf einem Bein geübt.»
«Ja, auf meinem rechten, das ist etwas schwächer als das linke.»
«Und Sie haben geübt, um auf einem Bein auf der Spitze des Messeturms zu stehen.»
«Ja.»
«Was soll das sein? Performance-Kunst? Oder vielleicht ein göttlicher Befehl?»
«Nein, ich wollte nur jemanden zum Essen einladen.»
«Auf der Spitze des Messeturms?»
«Nein, bei mir zu Hause. Aber dazu muss ich zehn Minuten auf der Spitze des Messeturms stehen. Auf meinem rechten Bein.»
Und das wäre vermutlich der Moment, in dem das Thorazin zu wirken anfängt.
Mit diesen Gedanken erreiche ich das Dachfenster und klettere hinein. Ich gehe in mein Zimmer und überprüfe meine Ausrüstung – die Sicherheitskarte, mit der ich in den Fahrstuhl komme, der Schlüssel für die Dachterrasse, die Kletterseile und die Saugnäpfe, mit denen ich die Pyramide erklimmen werde – eigentlich der schwierigste Teil des Ganzen, immerhin 15 Meter Glas muss ich überwinden. Dann die speziellen Schuhe: Ihre Sohlen sind elastisch und gleichzeitig stabil. Kletterer und Seiltänzer nutzen sie. Und natürlich die Videokamera, die meinen Stand aufzeichnen wird.
Morgen früh. Ich bin so weit, das Wetter ist günstig: Es wird ein klarer Tag ohne Wind werden – mit angenehmen Temperaturen in der Morgendämmerung. Später am Tag wird es sehr heiß sein, aber dann bin ich schon wieder unten. Der Flughafen wird bestreikt, sodass auch die Wirbelschleppen der Verkehrsmaschinen mich nicht gefährden können.
Morgen früh. Der Wecker wird um 3:30 Uhr klingeln, ich werde eine letzte Trainingsrunde absolvieren: Vom Bett auf den Schreibtisch, auf den Schrank, auf den Sitzball, auf den Hocker, von dort die Türklinke herunterdrücken, dann mit drei raschen Hüpfern ins Bad, ein paar Lockerungsübungen beim Zähneputzen, zurück in mein Zimmer, einbeinig anziehen und dann entspannt das Treppengeländer herunterlaufen und mit der U-Bahn zu meinem Ziel fahren. Der Pförtner wird mir kurz zunicken, während ich in den Fahrstuhl steige, er kennt mich schon, nimmt er wohl an, ich gehöre zu den exzentrischen Architekten, die seit Kurzem die oberste Etage nutzen. Und dann wird mein Aufstieg beginnen: mit dem Fahrstuhl zur obersten Etage, von dort auf die Dachterrasse, wo ich die Videokamera aufbaue, dann der Aufstieg auf die Pyramide. Oben angekommen werde ich die Seile lösen, die mich halten, und dann …
Morgen früh. Ich werde dort oben stehen, zehn Minuten lang, eigentlich etwas länger, denn ich werde meine Uhr erst starten, wenn ich sicher stehe. Dabei werde ich den Sonnenaufgang betrachten, bis meine Zeit um ist.
Morgen früh. Vermutlich hat meine Nemesis die Wette schon längst vergessen, es ist mehr als ein Jahr vergangen, aber das ist auch nicht mehr wichtig. Für mehr als ein Jahr hatte ich ein Ziel. Und morgen werde ich es erreichen.
Und dann? Was wird sein, wenn meine Armbanduhr zu piepen beginnt, wenn die zehn Minuten um sind?
Ich werde herabsteigen, zu meiner Nemesis gehen, ihr die Videokassette überreichen und sie freundlich fragen:
«Darf ich Sie jetzt zum Essen einladen?»
Vielleicht werde ich aber auch einfach meine Schwingen ausbreiten und in den Sonnenaufgang hineinfliegen.