Landauf, landab ist die Aufregung groß: Die SPD-Politikerin Kristin Rose-Möhring möchte die deutsche Nationalhymne geschlechtergerechter gestalten.
Genauer: Sie möchte zwei Wörter ändern. Aus „Vaterland“ soll „Heimatland“ werden, aus „brüderlich“ „couragiert“.
Man mag nun das Vorhaben und die ausgebrochene Debatte für eine gute Nachricht halten, denn offenbar ist die Gleichstellung der Geschlechter in diesem, unserem Lande inzwischen so weit vorangeschritten, dass wenig zu tun bleibt außer ein paar kosmetischen Korrekturen.
Oder man mag es als schlechte Nachricht ansehen, dass in Zeiten von #MeToo, Gender Pay Gap und gläserner Decke einer Politikerin nichts Besseres einfällt, um sich zu profilieren, als diese allenfalls feigenblättrige Initiative, die es zudem an Originalität missen lässt: Österreich und Kanada waren schneller und gründlicher. Gerade in Kanada ist der Schritt zum geschlechtergerechten „Oh Canada“ zudem nur ein kleiner Stein im Mosaik der Politik für mehr Gleichberechtigung.
Nun gut, meine Leidenschaft ist die Sprache. Schauen wir also mal unter diesem Aspekt auf die vorgeschlagenen Änderungen:
„Heimatland“ statt „Vaterland“?
Wie viele Deutsche meiner Generation kann ich auf das Wort „Vaterland“ gerne verzichten: „Für Volk und Vaterland“ oder „Fürs Vaterland sterben“? Nein, danke. So gesehen kann das Wort gerne auf den Müllhaufen der Geschichte.
Man sollte Hoffmann von Fallerslebens „Lied der Deutschen“ allerdings zugutehalten, dass es das Wort ausnahmsweise (!) in einen auch heute noch positiv konnotierten Kontext setzt: „Einigkeit und Recht und Freiheit“. Vielleicht wäre es ja allein aus diesem Aspekt sinnvoll, das Wort an dieser Stelle zu erhalten – und somit nicht vollständig dem rechten Rand zu überlassen.
Doch was ist mit dem Ersatz – „Heimatland“?
Geht es nur mir so oder fehlt „Heimatland“ – wohlgemerkt: nicht „Heimat“ – die positive emotionale Besetzung? Mir zumindest ist die Bezeichnung „Heimatland“ in den letzten Jahren ausschließlich im Kontext jener Gegenden der Welt begegnet, in die Politiker aller Couleur mal mehr, mal weniger militant jene zurückschicken wollen, die von dort in höchster Not zu uns geflohen sind. Dieses Wort jetzt in unserer Nationalhymne zu adeln, hat durchaus einen zynischen Beigeschmack.
„Couragiert“ statt „brüderlich“?
Während man über „Heimatland“ streiten kann, lässt dieser Vorschlag nicht nur Sprachgefühl, sondern auch Geschichtsbewusstsein missen:
„Courage“ betont man auf der zweiten Silbe, „couragiert“ sogar auf der dritten: Somit bricht das Versmaß zusammen. Um es zu erzwingen, müssten wir „KUH-ragiert“ singen –ob das musikalische Zelebrieren erzürnten, weiblichen Nutzviehs wirklich besonders frauenfreundlich oder geschlechtergerecht ist, sei mal dahingestellt.
„Couragiert“ wird darüber hinaus praktisch ausschließlich als Adjektiv verwendet, nicht als Adverb wie hier vorgeschlagen: Man erweist sich als couragierter Mensch, indem man mutig handelt. Notabene: Es ist schon recht vielsagend, dass wir meinen, für den mutigen Einsatz für andere unbedingt ein Wort aus einer anderen Sprache entlehnen zu müssen. „Zivilcourage“ ist ein Fremdwort – und das leider viel zu oft im doppelten Sinne. Aber ich schweife ab.
„Brüderlich“: Unterstellen wir dem liberal gesinnten Vormärz-Kämpfer Hoffmann von Fallersleben einmal, dass er wusste, was er tat und dieses Wort in seiner Referenz auf die Werte der französischen Revolution verwendet: Liberté, Egalité, Fraternité – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dass ausgerechnet eine SPD-Politikerin den Gedanken an Solidarität und Gemeinschaft – denn dafür steht Fraternité – aus der Nationalhymne streichen will, ist nicht frei von Ironie (und doch ganz auf Parteilinie). Und es zeigt einen eklatanten Mangel an Geschichtsbewusstsein.
Viel Lärm um nichts?
Nun könnte man sagen: Zwei Worte – in einem Lied, das zumeist ohnehin nur instrumental erklingt und vielleicht mal zur WM (und dann nicht immer ganz textsicher) gesungen wird? Wozu also die Aufregung über den gutgemeinten (wenn auch nicht frei von Profilierungsnot gemachten) Vorschlag einer Politikerin, von deren Existenz bis dato nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt wusste?
Vielleicht ist die Streichung des Gemeinschaftssinns aus der Nationalhymne und die Betonung des Einzelnen (couragiert ist man nur alleine gegen alle) einfach ein passender Schritt – eine Anerkennung des unsere Zeit prägenden Egozentrismus und ein Abschied vom Streben nach der gemeinsamen großen Erzählung, die uns einen Zusammenhalt jenseits des Tribalismus gibt.
Leider verläuft die Debatte aktuell einzig in der nicht besonders ausgeprägten Dichotomoie zwischen offenem nationalen Chauvinismus von rechts, und „Das haben wir doch immer so gesungen“ von mittig-links. Niemand stellt die Hymne als Ganzes in Frage: Dabei wäre gerade das dringend notwendig.
Das „Lied der Deutschen“ gehört auf den Müllhaufen der Geschichte
Sein Text, der historisch inzwischen so belastet ist, dass allenfalls noch die dritte Strophe ernsthaft gesungen werden kann, auch wenn die zweite Strophe „Deutsche Frauen, deutsche Treue“ in seinem Lob auf die teutonische Weiblichkeit eine Alternative für eine geschlechtergerechte Hymne wäre.
Seine Melodie: Die boshafte Ironie, dass Fallersleben sein als Hohelied auf die Demokratie gemeintes Gedicht ausgerechnet auf das Monarchie-verherrlichende Kaiserquartett des Österreichers Haydn schrieb, dürfte heute kaum noch im Bewusstsein der Singenden sein: Im Gegenteil: „Wir wollen unseren Kaiser wiederhaben“ – diese Forderung schwingt implizit mit, wenn von rechts außen der Ruf erschallt, man solle die Soldaten des Ersten Weltkriegs wieder in ihrer Heldenhaftigkeit ehren.
Und ob gerade die deutsche Nationalhymne wirklich aus der Feder eines Dichters stammen sollte, dessen „Heimatlandsliebe“ auch gerne mal in offenen Chauvinismus und in die Ablehnung alles Fremden umschlug und der sich ein übers andere Mal antisemitisch äußerte, wage ich auch zu bezweifeln.
Wenn schon eine Alternative – dann bitte richtig!
Wir sind – oder waren es einmal – unserem Selbstverständnis nach das Volk der Dichter, Denker und Musiker. Da sollte sich in unserem reichen Schatz an Kompositionen und Dichtwerken doch ein Musikstück und ein Text finden lassen, hinter dem wir Deutschen uns heute gemeinsam versammeln können – unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe oder Sexualität.
Denn gerade jetzt – in diesem Vorschlag zu einer geschlechtergerechten Hymne – bietet sich eine Chance: Wir sollten genau diesen Widerstreit als Initialzündung zu einem Austausch über unsere nationale Identität und unser nationales Bewusstsein nutzen. Eine Debatte, die dringend notwendig ist; die viel zu lange dem rechten Rand überlassen wurde; und – dieser Meinung bin ich sicher nicht allein – nicht unbedingt gut aufgehoben ist in einem vorrangig bayrisch geprägten Heimatministerium. Und wenn am Ende dieser Debatte ein neues Symbol für unsere Identität steht – umso besser.
Postskriptum
Eines sollten wir allerdings nicht tun: Die Komposition der Hymne samt Text neu ausschreiben. Schon gar nicht unter Federführung der SPD: Mit Schrecken erinnere man sich an „Weiches Wasser bricht den Stein“. Uns stünde bestimmt eine Udo-Lindenberg/Helene Fischer-Kooperation ins Haus.
Dann doch lieber
„Einigkeit und Recht und Freiheit“
meinetwegen „für das deutsche Heimatland“.
Danach können und sollten wir gerne weiter streben.
Aber bitte – wenn schon, denn schon – sozialdemokratisch-arbeiterklassig:
„Arm in Arm mit Herz und Hand“.
Da möchte man doch gleich die Faust recken zum revolutionären Gruß – als den Hoffmann von Fallersleben sein Gedicht einst gemeint hat.




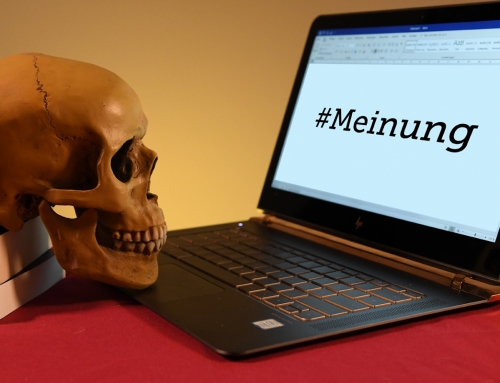
Hinterlasse einen Kommentar