Manche mögen sich erinnern: Ich habe diese Serie mit einem Ausflug zu intrinsischer und extrinsischer Motivation begonnen.
In diesem Tipp möchte ich darüber sprechen, wie tendenziell extrinsische Motivation in Form von externen Zielen einen Text in der Überarbeitung verbessern kann.
10 % können immer raus: Kürzen, aber wie?
„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“
Dieses Credo von Antoine de Saint-Exupery beten wir Autoren gerne nach. Doch seien wir mal ehrlich: Jeder Strich schmerzt wie eine kleine Amputation und es fällt uns schwer, unseren so hart errungenen Worten Leid anzutun.
Genau hier hilft ein externes Ziel: Schon in meinem Brotberuf als Werbetexter muss ich meine Texte oft kürzen, sei es, weil sich Vorgaben ändern, sei es, weil ich ohnehin zur Überlänge neige. Ich bin also durch externe Gründe gezwungen. Das macht die Arbeit des Streichens gleich sehr viel einfacher.
Dieses Prinzip mache ich mir auch bei meinen Romanen zunutze: Wenn ich nicht ohnehin Verlagsvorgaben habe, setze ich mir für die große, erste Kürzungsrunde die Regel: Zehn Prozent vom Text müssen raus. Das klingt nach nicht besonders viel? Wenn ein Manuskript 300 Seiten hat, müssen 30 davon raus: Das ist schon ein ganz schöner Packen Papier.
Nun gut, der Text wird kürzer; aber warum wird er auch besser? Ganz einfach: Bei Kürzungen in so großem Umfang muss ich jedes Element vom Handlungsstrang bis zum Adjektiv auf dessen Notwendigkeit abklopfen. Der Text wird ökonomischer, leichter lesbar und präziser. Außerdem fallen mir bei so detaillierter Betrachtung oft noch bessere Lösungen oder Ausdrücke ein.
Zudem kann ich so eines meiner Lieblingsprobleme lösen: Ich steige oft zu früh in eine Szene ein und noch viel häufiger zu spät aus: Meine Charaktere stehen dann in der Gegend herum und verbrauchen Luft und Seitenfläche. Nach der Kürzung entlasse ich den Leser aus dieser Szene mit einem Lacher oder einer großen Frage – die ihm dann in der nächsten Szene beantwortet wird.
Sprachspielregeln
Ähnlich profitiere ich auch anderweitig von Vorgaben, die nicht direkt mit dem Text selbst zu tun haben. Das ist eine Lektion, die ich aus dem Umgang mit Styleguides gelernt habe, die viele große Unternehmen in ihren CI-Handbüchern führen. Darin sind Sprachstil und Ansprache der Leser*innen vorgegeben – oftmals sehr detailliert. Das ist zunächst einmal eine Beschränkung. Aber gerade deshalb bin ich gezwungen, sehr viel genauer auf meine Worte zu achten.
Deshalb gebe ich mir für jeden Roman bestimmte Richtlinien vor, die oft willkürlich wirken, jedoch eine ganze Kette positiver Konsequenzen haben.
In meinem letzten, noch nicht veröffentlichten Roman zum Beispiel habe ich mir selber die Aufgabe gestellt, auf jede Qualifizierung wörtlicher Rede zu verzichten. Jedes „sagte/schrie/flüsterte/brüllte/nuschelte/zischte etc.“ fiel gnadenlos den Rotstift zum Opfer. Im Gegenzug hatte ich dann die Aufgabe, auf anderen Wegen zu verdeutlichen, wer gerade spricht; und, falls nicht ohnehin erkenntlich, wie er es tut: Jemand mit lila Zornesflecken auf den Wangen spricht anders als jemand, der gerade aus dem Bett gekrabbelt ist. Will man jetzt noch Erklärungen vermeiden („Show, don’t tell“), hat das Auswirkungen auf die gesamte Sprache des Textes – und nicht nur ich finde, dass dieser Roman der bisher sprachliche Beste von mir ist.
Fazit
Die externen Vorgaben, seien es nun Kürzungen oder Sprachspielregeln, zwingen mich dazu, sehr viel bewusster und genauer zu schreiben und zu überarbeiten. Zudem zwingen sie mich zu Strichen und Änderungen, die mir zwar zunächst wehtun – von denen ich aber weiß, dass sie letztlich den Text besser machen. Und wenn nicht – nun, bis zur Drucklegung kann man immer noch alles ändern.


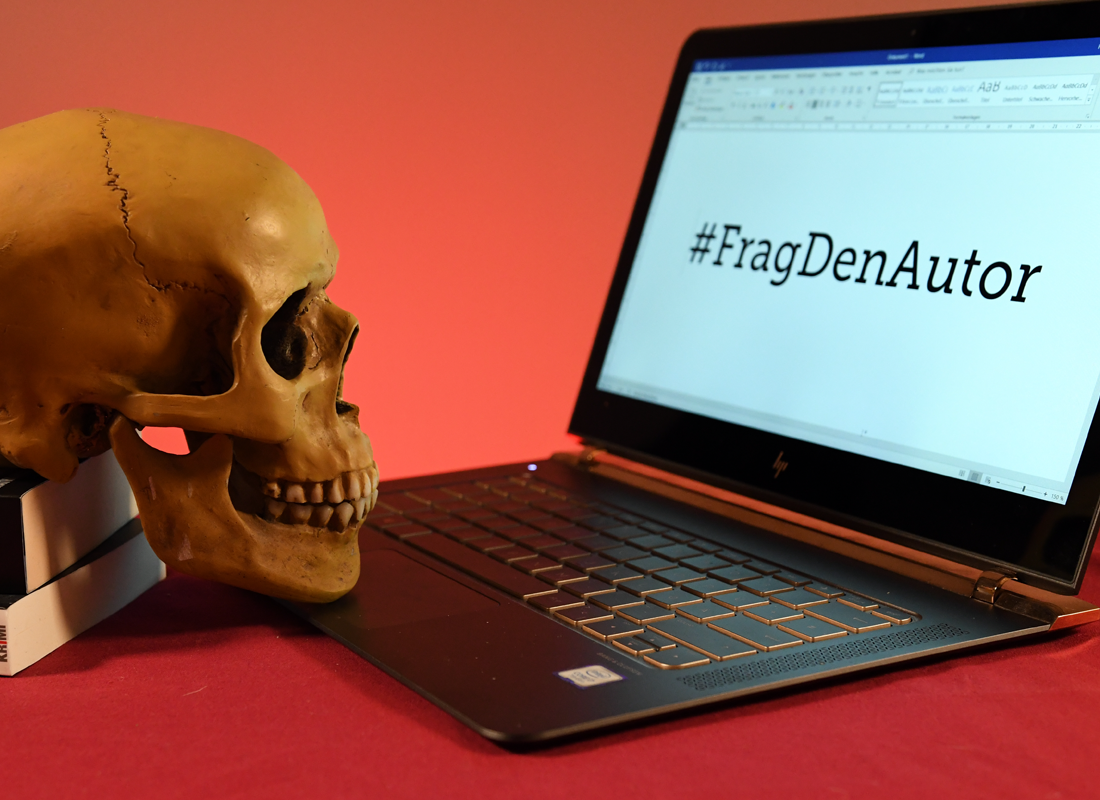
![[SHOUTOUT] To Marc from Covervault](https://helmut-barz.de/wp-content/uploads/2019/06/05-JazzTrilogie-500x383.jpg)
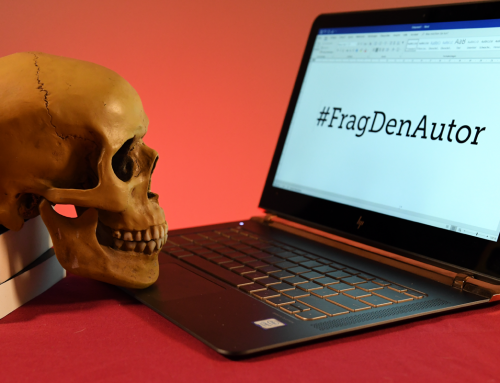
Hinterlasse einen Kommentar